Donnerstag, 30. August 2012
Step Up "Miami Heat" + To Rome with Love
dopo, 13:11h

Hurra, Hurra wieder ein Tanzfilm, der in die Kinos kommt. Hey, wir tanzen für unser Leben gern, niemand hat einen Plan B und um in der Tanzcrew zu landen, muss man einigen Beef, Intrigen und Liebesscheiß überstehen. Denn am Ende steht das große Battle an, was beinahe verloren, am Ende dann doch siegreich in die Hood geholt wird. Jetzt also Step Up 4.
Im Groben lassen sich die Drehbücher von Tanzfilmen der letzten fünf Jahre in diesen Worten zusammenfassen. Wenn man sich den Trailer zum vierten Teil der Step Up Reihe anschaut, erwartet man das Gleiche wieder, selbstverständlich mit spektakulären Choreographien und fantastischen Kameraaufnahmen. Umso überraschender ist der Aspekt, dass hier gleich einige Dinge komplett anders und viel besser gemacht werden.
Stundenlanges Rumgelaber findet hier nicht statt, stattdessen ist mehr als die Hälfte der Laufzeit tatsächlich Tanz. Aufgrund der Flashmobthematik, die zwar etwas oberflächlich behandelt wird, aber Farbe ins Tanzfilmeinheitsgrau bringt, sind die Locations allesamt kreativ ausgewählt worden. Die Choreographien und Kostüme sind teils atemberaubend geworden und perfekt zur Musik angepasst worden. Der Soundtrack beinhaltet viele pumpende Partykracher, ist sich aber auch nicht zu schade ein paar unbekanntere Stücke zu introducen. In den besten Momenten des Films fühlt man sich, als würde man in einer Cirque du Soleil Performance sitzen.
Die 3D Effekte sind sinnvoll eingesetzt worden und bieten Raum für die Performances der Tänzer. Technisch ist wirklich alles perfekt.
Das Finale ist tatsächlich kein Tanzbattle geworden, sondern auch hier traut man sich über die langweiligen Konventionen hinaus. Hier wird um ein altes Viertel gekämpft, was schicken Bürogebäuden und Einkaufszentren weichen soll. Welche Großstadt muss sich aktuell eigentlich nicht gegen derartige Vorhaben wehren, um Flecke des Lebens aufrecht zu erhalten, die Generationen geprägt haben. Hier gibt es logischerweise ein Hollywood-Ende, was man sich für viele Ecken in Deutschland ebenfalls wünschen würde. Belasst etwas mehr Dreck und Seele in den Städten, wie auch in den Filmen. Die Aussage macht Step Up 4 nicht bloß, sondern hält sich im direkten Genrevergleich auch dran, wenn auch mit Hochglanzbildern und viel Naivität.
8/10

Letztes Jahr hatte Woody Allen mit Midnight in Paris einen der schönsten und besten Filme der letzten Jahre kreiiert. Seine Liebeserklärung an das Leben und den Anstoß den Blick auf die Gegenwart, nicht die Vergangenheit zu richten, war so voller Herzblut, dass man den Film lieben musste. Nun gehen wir von der einen europäischen Metropole in die nächste Weltstadt. Rom.
Bereits nach wenigen Szenen fällt total auf, es ist ein Woody Allen Film. Seine charmante Erzählweise bringt er auch in diesem Episodenfilm unter. Diese Geschichten sind auf den ersten Blick witzig und liebenswürdig, werden aber nach und nach an einigen Stellen der Lächerlichkeit preisgegeben.
Ob die Geschichte der beiden Landeier, die in der Stadt nicht zurecht kommen wollen, der talentierte Vater, der plötzlich zum Opernstar mutiert oder Roberto Bengini als Star wider Willen und ohne Grund: Alle Elemente werden hervorragend eingeführt, scheitern am Ende letztlich am schwachen Drehbuch.
Dagegen sind die Bilder von Rom unglaublich beeindruckend, dass dieses Bildband beinahe schon den Kinobesuch allein rechtfertigt. Legendär wären auch einige Szenen des Films, wenn sich in der Gesamtinszenierung nicht kläglich wegbrechen würden. Wer großzügig über Schwächen hinweg schauen kann, sich an einigen geschickt platzierten Gags erfreuen kann, die spektakuläre Besetzungscouch kennenlernen will und ein Fan der Stadt Rom ist, darf den Film getrost im Kino anschauen gehen.
6/10
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 7. August 2012
Prometheus
dopo, 16:23h

Lange Zeit verdichteten sich die Gerüchte über eine mögliche Alien-Fortsetzung, plötzlich stand das Wort Prequel, die Vorgeschichte, im Raum. Letztlich ist „Prometheus“ ein Mix aus beidem geworden.
Im Jahre 2085 wird in Piktogrammen alter Kulturen eine Sternenkarte entdeckt, die Hinweise auf den Schöpfer der Menschheit beinhaltet. Deswegen macht sich die Archäologin Elizabeth Shaw wenige Jahre später mit ihrem Team und dem Raumschiff Prometheus auf eine Reise zu sehr entlegenen Orten im Weltall. Am Ziel angekommen weicht die Faszination und Hoffnung schnell der Angst und Panik. Denn die entdeckte Alienrasse wird zur absoluten Bedrohung und der Wettlauf mit der Zeit beginnt.
Der Plot schreit nach hochkarätiger Action, die der Zuschauer auch bekommen soll. Allerdings lässt sich Ridley Scott nicht auf ein klassisches Actionmärchen ein, sondern spickt sein Werk mit zahlreichen Anspielungen auf die Alien-Quadrologie. Die Anfangsminuten bestechen durch eine Langsamkeit in der Inszenierung, die sich an dem sensationellen Setdesign ergötzt und jedes Detail in aller Ruhe ausleuchtet. Die beklemmende Atmosphäre baut sich so von Minute zu Minute weiter auf bis sie schier unerträglich wird. Wer einen schnellen Einstieg in einen Film bevorzugt wird hier auf eine Geduldsprobe gestellt.
Ridley Scott hat einen fast perfekten Film geschaffen. Die Schauspieler überzeugen durchgehend, allen voran Nomi Rapace als Elizabeth Shaw und Michael Fassbender als Android David, das bereits erwähnte Setdesign ist wunderschön zwielichtig geworden und der komplette Sound, von Toneffekten bis hin zum Score, blasen die Ohren komplett weg. Selbst der 3-D-Effekt lohnt sich und das obwohl Großteile des Films von der Dunkelheit der Bilder leben. Einzig das Drehbuch wirft Fragen auf, die Inszenierung hätte durchaus schlüssiger und sinniger werden können. Denn nicht selten stellt man das Handeln der Protagonisten ein wenig in Frage, wie auch das Einführen von Figuren, die letztlich überhaupt keine Rolle für den weiteren Verlauf der Geschichte darstellen.
Fans der Alien-Reihe werden begeistert sein, aber auch Alien-Fremde kommen voll auf ihre Kosten. Die Geschichte funktioniert nämlich auch ohne Vorkenntnisse wunderbar. Über die altmodische Herangehensweise könnte man streiten. Jedoch ist es im Jahre 2012 sehr erfrischend, dass dem Zuschauer viel Zeit geboten wird, sich in den Film einzuarbeiten und die Atmosphäre aufzusaugen. Anspruchsvolles Blockbusterkino darf und sollte genau so aussehen.
9/10
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 2. August 2012
Merida - Ted - Der Vorname
dopo, 13:14h

Mittlerweile dürfen Unwissende kritisch beäugt werden, die den Kopf schütteln, wenn sie den Namen Pixar hören und keine Kenntnis über deren Filmografie der letzten knapp 20 Jahre besitzen. Zur absoluten Sicherheit soll an dieser Stelle noch mal gesagt sein: Animationsmeisterwerke der Sorte Toy Story, Findet Nemo, Wall-E, Ratatouille oder Oben stammen aus der Feder der Kreativpioniere. Familienunterhaltung mit der entscheidenden zusätzlichen Ebene, welche die bisherigen Filmen nicht nur originell, sondern einige genial werden ließ.
Jetzt erscheint wieder ein Originalfilm (die letzten beiden Produktionen waren Sequels) und spielt an einem ungewöhnlichen Ort, an dem man keinen Familienfilm zwingend erwarten würde. In Schottland. Merida ist die Königstochter und soll vermählt werden. Dazu rufen ihre Eltern ein Turnier aus, an dem die befreundeten Stammesführer ihre Söhne zur Thronfolge animieren wollen. Merida will dagegen ihre Freiheit genießen und selbst über ihr Leben entscheiden.
Normalerweise gibt es in einer Pixarproduktion fast nur ausschließlich Positives zu berichten. So konventionell die Geschichte jedoch als Klappentext klingt, so folgt auch die Umsetzung im Drehbuch. Trotz des geschickten Storykniffs, der in keinem Trailer verraten oder angedeutet wird, geht die Geschichte in eine Richtung, wie wir sie schon oft auf der Leinwand haben sehen können. Das nimmt dem sensationell animierten Spektakel schon ein wenig den Zauber. Dank herausragender Bilder, schönen 3D-Effekten und tollen Charakteren wird Merida zwar nicht zur Filmlegende, dafür aber zu einem sehr unterhaltsamen Kinoabenteuer.
8/10

Die Family-Guy Macher wagen sich an ihren ersten Realfilm, der in den USA die Überraschung des Kinosommers darstellt. Die Idee aus einem süßen Kuschelbär den Begleiter des Lebens werden zu lassen, klingt erst einmal nach einem kitschigen Weihnachtsfilm. Genial ist der Sprung in das Erwachsenenalter, wobei nicht nur das Kind, sondern auch der Bär eine nicht unwesentliche Entwicklung durchgemacht hat.
Mark Wahlberg spielt die Hauptfigur mit der notwendigen Lässigkeit, die unbedingt notwendig für diese Rolle war. Knuddelbär TED ist im Jahre 2012 ein dauerschimpfender, kiffender und trinkender Rauzahn, der nur mit seinem Buddy abhängen will.
Die im Trailer gezeigte Situationskomik und teils extreme Derbheit hält der Film in dem famosen Anfangstempo leider nicht durch. Zum einen gehen einige Witze einfach so dermaßen daneben, zum Anderen ist die zweite Storyline in Sachen Liebesgeschichte und Entführung völlig deplatziert und zieht unnötig Drive aus der Produktion. Dennoch wird der Kinobesuch mit einigen legendären Szenen und Gags belohnt, die noch lange im Gedächtnis bleiben werden. Hier wäre weniger wieder einmal mehr gewesen.
7/10

Französische Produktionen haben in diesem Jahr in Deutschland Hochkonjunktur und dementsprechend erscheint jeder Hit von unseren Nachbarn zeitversetzt auch bei uns. „Der Vorname“ erinnert in seinem Grundaufbau ein wenig an „Der Gott des Gemetzels“, der auch fast ausschließlich in einer einzigen Wohnung spielt.
Durch einen einzigen schlechten Witz entsteht eine Kettenreaktion, die viel Wahrheit, Frustration und Unausgesprochenes für jeden Einzelnen bereithält. Das ist authentisch, intelligent, unterhaltsam und an einigen Stellen schlichtweg genial geschrieben. Die sympathischen Schauspieler brillieren durch die Bank weg, sodass nicht einmal die kleinen Längen wirklich stören. Eine Filmperle aus Frankreich.
9/10
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 23. Juli 2012
Batman - The Dark Knight Rises
dopo, 12:56h

Es spielt keine Rolle wie man zum Mainstreamkino der Traumfabrik Hollywood, ebenso wenig wie allgemein zu Comicverfilmungen und nicht einmal zum Film selbst steht, Christopher Nolan hatte im Jahre 2008 mit „The Dark Knight“ etwas erreicht, was in den 00er Jahren bislang den allerwenigsten Filmemachern gelungen war: Er hat eine Rolle, einen Bösewicht für die Ewigkeit geschaffen, über den man noch in 30 Jahren sprechen wird. Über den tragischen Tod von Heath Ledger ist in diesem Zusammenhang schon genug gesprochen und philosophiert worden. Entscheidend zum Filmstart von „The Dark Knight rises“ ist lediglich eine Frage. Nicht etwa, wie gut das Drehbuch sein wird. Jeder weiß im Jahre 2012, dass Christopher Nolan in Zusammenarbeit mit seinem Bruder Jonathan ein grandioser Autor ist. Es ist auch nicht wichtig, wie visuell einzigartig der Film oder wie packend die Inszenierung geworden ist. Handwerklich ist an den Blockbusterproduktionen sehr selten etwas zu kritisieren. Entscheidend ist am Ende doch, wie sehr der Joker und damit Heath Ledger den letzten Teil geprägt hat.
Die Zeiten in Gotham City sind düster, wieder einmal. Acht Jahre nach dem Tod von Harvey Dent, wird dieser immer noch als Held mit eigenem Feiertag verehrt, obwohl er sich am Ende seiner glorreichen Laufbahn als Staatsanwalt selbst dem Bösen hingegeben hatte. Das Böse scheint vorerst aus dem Weg geräumt worden zu sein, doch die wahre Bedrohung wartet noch auf die Menschen der Stadt. Der erbarmungslose Terrorist Bane, der eine mysteriöse Atemmaske trägt, will die ganze Stadt für Dekadenz und Kapitalismus bestrafen. Sein Handeln lockt den verlotterten Bruce Wayne und somit Batman nicht nur aus seinem Versteck, sondern zurück in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Batman muss ich dem Bösen erneut stellen und trifft dabei auf einen hartgesottenen Gegner.
Christopher Nolan ist erneut das Kunststück gelungen, 165 Minuten wie einen Kurzfilm vergehen zu lassen. Die komplexe Story, die ohne Probleme und moralischem Zeigefinger wirtschaftliche und politische Missstände aufzeigt, diese dabei glücklicherweise nicht komplett in den Vordergrund zu rücken versucht. Hier handelt es sich um eine Comicverfilmung, die von Grund auf schon sehr wenig comicartig daher kommt – so wenig Batman und so viel Bruce Wayne gab es wohl nie. Dennoch wird dem Zuschauer eine Vielfalt an Interpretationsmöglichkeiten geboten und insbesondere Michael Caine als Butler Alfred verlässt die Szene niemals ohne zum Abschluss eine Lebensweißheit zu Besten zu geben.
Allgemein ist die Schauspielerriege mehr als hochkarätig besetzt. Christian Bale, Anne Hathaway, Morgan Freeman, Gary Oldman, Liam Neeson, Marion Cotillard und Michael Caine. Joseph Gordon-Levitt stiehlt jedoch allen die Show. Er agiert als Polizist mit engerer Verbindung zu Batman subtil, leidenschaftlich und unglaublich mehrdimensional. Wenn jetzt die deutsche Synchronisation dem Herren eine ähnlich dunkle Stimme zuweisen würden, wie er sie im Original hat, würde man ihn auch hier mehr als Kerl statt als Milchbubi wahrnehmen.
Der zweite große Star ist das Drehbuch. Der Zuschauer darf sich niemals sicher sein die Szenerie durchschauen zu können. Die unglaubliche Anzahl an Finten, die geschlagen werden, ist für eine kommerzielle Verfilmung wirklich erstaunlich.
Die ursprüngliche Frage ist aber immer noch nicht beantwortet und die Antwort entwickelt sich erst nach dem Filmbesuch. Heath Ledger hat „The Dark Knight“ zu dem gemacht, was er heute noch ist und die Rolle des Jokers wird hier schmerzlich vermisst. Dabei kann man Tom Hardy keinerlei Vorwürfe machen. Aufgrund der Maske ist jeder Einsatz von Mimik völlig unmöglich. Die Rolle selbst ist auch eher plumper ausgelegt und dementsprechend agiert Terrorist Bane im Film. Er ist ein gewaltverherrlichender und aufgepumpter Punk, der die Welt zerstören will. Humorige, schräge oder verstörende Einlagen gehören daher nicht zur Tagesordnung. Der geniale Schachzug wird anders gezogen und sorgt für einen fantastischen Twist am Ende.
Negativ betrachtet macht das Fehlen des Jokers den Film schwächer, positiv gesehen braucht „The Dark Knight rises“ keine One-Man-Show, sondern überzeugt als bester Blockbuster des Sommers. In Gotham City ist es düster genug, wir denken positiv.
9/10
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 15. Februar 2012
Gefährten
dopo, 15:53h

In den 90er Jahren war es ein Ereignis sondergleichen, wenn ein neuer Spielberg-Film die große Leinwand bespielen durfte. Ob Hook, Jurassic Park, Schindlers Liste oder Der Soldat James Ryan: Auf der ganzen Welt rannten sie in Scharen in die Säle. Ja, es war sogar ganz gleich, was es für ein Film war – sofern Spielberg Regie führte, war das Grund genug eine Karte zu lösen. Steven Spielberg ist und bleibt wohl der einzige echte Regie-Star, den Hollywood je hatte. Nach einer Auszeit ist Spielberg nun wieder präsent wie lange nicht. Erst die Produktion von Super 8, dann Tim und Struppi und nun erscheint sein Gefährten auch in Deutschland. Die Geschichte des Pferdes Joey, was Völker verbindet, Menschen glücklich macht und am Ende des Films seinen ursprünglichen Besitzer Albert mitten im Krieg wiederfindet, basiert auf einem Buch und wurde in London auf die Theaterbühne gebracht. Was hier überkitschig klingt, ist in der Ausführung noch weitaus schmerzhafter.
Spielberg trägt dick auf und wenn man glaubt das Gröbste überstanden zu haben, setzt er noch einen oben drauf. Völlig überzuckert und weltfremd läuft der überlange Film am Zuschauer vorbei. Charmant und subtil ist hier nichts, alles wird mit der Brechstange erzwungen, jedes Gefühl wird mithilfe der Musik und der Bildsprache erzwungen. Was dieses Pferd jetzt so besonders macht, dass wirklich JEDER ALLES IMMER SOFORT stehen und liegen lässt, um Joey zu huldigen und ein besseres Leben zu ermöglichen, bleibt immer unbeantwortet.
Bereits in der Eingangssequenz wartet man auf ein Stück Butter in der rechten Ecke: KERRYGOLD. Logisch, Spielberg kennt sein Handwerk und so ist der Film aus der technischen Sicht absolut perfekt. Kamera, Ausstattung, Sound und und und. Wirkliche Emotionen weckt er dabei nicht, sondern bildet inspirationslos die Filme des goldenen Filmzeitalters ab. Wäre „Vom Winde verweht“ mit der heutigen Technik gedreht worden, er würde wohl exakt so aussehen. Blöd nur, dass dieser Klassiker nun 73 Jahre alt ist und die Art und Weise des Erzählens nicht mehr zeitgemäß ist.
Wer also Kitsch liebt , sich in satten Farben suhlen möchte, große Bilder auf der Leinwand sehen mag und eine Geschichte aus der Sicht des Pferdes erzählt bekommen werden will, ist hier richtig. Dem Rest wird dringend von „Gefährten“ abgeraten, denn es würde ein unerträglicher Kinobesuch werden. Tierfreunde schauen lieber noch einmal Flipper, Lassie und Black Beauty, wahlweise schlägt noch einmal in der Wendy nach. Ach Steven, deine glorreiche Zeit bleibt unvergessen, aber sowas hier sorgt nicht für Vorfreude auf neue Produktionen von dir.
2/10
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 10. Februar 2012
Hugo Cabret + Für immer Liebe + Die Unsichtbare
dopo, 01:39h

Man muss schon zweimal hinschauen, um wirklich zu glauben, dass dies ein Film von Martin Scorsese ist. Der Mann, der seine Protagonisten gerne vor Abgründe stellt, hat eine bildgewaltige Hommage an das frühe Kino Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in wunderschönen Bildern gedreht. Normalerweise würde Scorsese den Hauptschauplatz (hier: ein Bahnhof) in schmutzigen Aufnahmen einbetten, in HUGO CABRET leuchtet der Bahnhof in warmen Farben, Schmutz sucht man vergeblich, der „Bösewicht“ ist skurril überzeichnet und sorgt gar für herzhaftes Lachen. Dieser kleine Kosmos wird dem Zuschauer auch noch in 3D serviert, was bei diesem Regisseur die zweite Überraschung ist. Wenn doch jeder Filmemacher aus Hollywood so viel Liebe und Herzblut bei der technischen Ausführung stecken würde, wäre 3D beliebter denn je.
Zur Geschichte: Der Waisenjunge Hugo arbeitet im Bahnhof von Paris als Uhrenwächter; er sorgt dafür, dass keine einzige Uhr stehen bleibt. Nach dem Tod seines Vaters hat ihn sein Onkel unter seine Obhut genommen bzw. er zwingt Hugo diesen Beruf zu lernen und nicht mehr zur Schule zu gehen. Dabei muss Hugo sehr vorsichtig seine Arbeit verrichten, denn der Stationsaufseher (urkomisch gespielt von Sacha Baron Cohen) macht Jagd auf alles, was den Betrieb durcheinander bringen könnte – somit auch auf Waisenkinder. Das Einzige, was Hugo noch besitzt, ist eine mechanische Metallfigur, die er reparieren will, um dem Geheimnis hinter der Figur und vielleicht gar der eigenen Vergangenheit auf die Spur zu kommen. Ein großes Abenteuer beginnt, was im schönsten Filmfinale der letzten 12 Monate endet.
Auch wenn die Geschichte am Anfang etwas schwerfällig in Fahrt kommt und sich unglaublich viel Zeit nimmt die Figuren vorzustellen, der Zuschauer wird belohnt und das bereits bevor ein genialer Kniff im Drehbuch das kinderfilmartige Abenteuer in eine liebevolle Liebeserklärung an das Kino umwandelt. Diese Wandlung bringt die Kinomagie auf die Leinwand, der in den Szenen gehuldigt wird. Ebenso ist es ein Wunder, wie ein techniküberfrachteter Film für 170 Millionen Dollar so viel Seele haben kann und sich trotzdem niemals unecht anfühlt. Kamera, Sound, Score und die 3D Effekte sind allesamt sensationell. Der Kauf der Kinokarte lohnt sich dreimal und die Oscarnominierungen in sämtlichen Kategorien sind absolut gerechtfertigt. Ohne die Schwächen am Anfang wäre es ein Meisterwerk sondergleichen geworden, so ist es nicht wirklich weit davon entfernt.
9/10
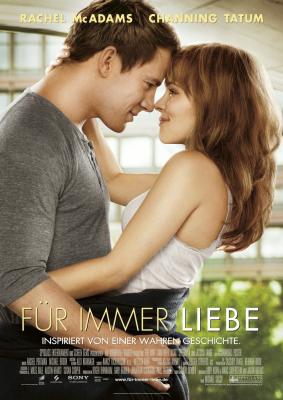
Pünktlich zum Valentinstag muss natürlich eine der tollsten Liebesgeschichten aller Zeiten verfilmt werden. Alle Jahre wieder. In diesem Fall scheint die Ausgangssituation auch wirklich für viel Herzschmerz sorgen zu können. Das junge Paar Leo und Paige sind überglücklich verheiratet und führen ein unkonventionelles Leben. Durch einen tragischen Unfall verliert Paige ihr Gedächtnis und kann sich nicht mehr an ihren Ehemann erinnern, dafür aber an ihr Leben weit vor dem Kennenlernen von Leo. Wie gelingt es Leo nun Paige wieder in das Hier und Jetzt zu holen, wird sich Paige jemals wieder erinnern oder nochmals in ihren Traummann verlieben?! Beim ersten Drehbuchentwurf muss nun jeder Filmemacher entscheiden, in welche Richtung sein Werk gehen soll und wie real die Geschichte aufgebaut werden soll.
Leider wurde sich für eine recht amerikanische Variante entschieden. Überall gibt es spannende Ansätze in den Figuren, nur sehr selten wird dem nachgegangen, sodass sich das Geschehen stets nur auf der Oberfläche bewegt. Natürlich soll ein romantischer Film keine tiefgründige Charaktersezierung sein, letztlich würde ein mehrdimensionaler Ansatz für mehr Glaubwürdigkeit sorgen und letztendlich auch für mehr Romantik. Stattdessen verliert sich „Für immer Liebe“ in einer Ansammlung von Klischees: Paige ist mit ihren Eltern hoffnungslos zerstritten, welche die Amnesie ihrer Tochter natürlich für Wiedergutmachung nutzen wollen. Leider ist der vorweg gegangene Bruch mit den Eltern komplett unglaubwürdig dargestellt, wie auch die grundsätzliche Charakterzeichnung und Entwicklung. Niemand nimmt Channing Tatuum als Leo wirklich ab, dass er ein eigenes Tonstudio besitzt und Musik sein Leben ist. Wieso aus der spießigen Paige (teils wirklich nervig: Rachel Mc Addams) die Künstlerin wurde, bleibt unerwähnt, ebenso warum sie ihrer vergessenen Vergangenheit derart uninteressiert entgegen blickt. Hier äußert eine Ärztin einen psychologischen Verdacht, der im Film wie so ziemlich alles bedeutungslos ins Leere läuft.
So erstickt der Film viele romantische Momente und Möglichkeiten im Keim und macht aus der großartigen Liebesgeschichte, die gar auf wahren Begebenheiten beruht. Massenweise Potenzial wird fast schon respektlos in die Ecke geworfen und so wird eine schier unendlich romantische Story gegen ein unbedeutendes Abziehbildchen ausgetauscht. Da hilft es auch wenig, dass am Ende auf ein überkitschiges Ende verzichtet wird und der Orchestergraben im Soundtrack keinen Platz gefunden hat. Die letzten Momente des Films haben mehr Charme und Authentizität als die übrigen Filmminuten vorab. Sehr schade, aber der Valentinstag und die angekündigten Ladies-Nights werden den notwendigen Erfolg schon bringen. Die Taschentücher bleiben jedoch die meiste Zeit trocken.
5/10

Kaum läuft der Trailer zum Film „Die Unsichtbare“, der bereits im Sommer 2010 gedreht wurde, im Netz, schon häufen sich kritische Kommentare ohne den Film in der Gesamtlänge überhaupt gesehen zu haben. Nein, dieser Film hat nur in geringem Maße mit „Black Swan“ zu tun und bis auf Teile der Grundsituation sind die beiden Inszenierungen so unterschiedlich, wie nur sein können. Die Schauspielschülerin Fine wird auf Ihrer Schule nicht sonderlich geachtet. Zu unsicher, zu unbeholfen agiert sie auf der Bühne. Ihr wird geraten, einen neuen Beruf zu lernen. Dabei stehen unverschuldete private Probleme in Ihrem Weg. Ihre Schwester ist schwerstbehindert und benötigt jede Hilfe, die möglich ist. Fine war bisweilen immer in Sachen Aufmerksamkeit und Zuneigung an zweiter Stelle, was auch ihrer leicht depressiven Mutter bewusst wird. Nun will der bekannte Regisseur Kaspar Friedmann sein neues Stück ausschließlich mit Schauspielstudenten besetzen und sucht Fine völlig überraschend für die Hauptrolle aus und wird insbesondere von ihr noch alles abverlangen.
„Die Unsichtbare“ ist eine tiefgründige Charakterstudie, die persönliche Probleme der Darsteller ernst nimmt und den Blick für ihr Leben offen hält. Die Figuren sind echt, sie atmen die gleiche Luft wie der Zuschauer und bleiben nonstop konstant auf Augenhöhe. Es gelingt Regisseur Schwochow einen schier unendlich realistischen Einblick in die Arbeit von Bühnenschauspielern und belässt die authentische Einstellung seines Films konsequent bei, was dann auch der entscheidende Unterschied zum offenbaren Ebenbild „Black Swan“ ist. Hier werden keine horrorfilmartigen Einstellungen benötigt, niemand ist derart psychisch krank, dass er sich selbst nicht mehr wahrnimmt und die Mutter-Tochter-Beziehung findet auf einer schmerzhafteren Ebene statt. Dieser Realismus macht dieses Werk zu einem großen Highlight der jüngeren deutschen Filmgeschichte.
Die dänische Hauptdarstellerin Stine Fischer Christensen überzeugt in jeder Einstellung und offenbar ihren seelischen Zustand dem Zuschauer, der von ihrer Darstellung angesogen wird. Das ist atemberaubend, spannend, emotional und am Ende letztlich: großes Kino.
9/10
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 4. Februar 2012
Moneyball - Dame, König, As, Spion - Sex on the beach
dopo, 13:10h
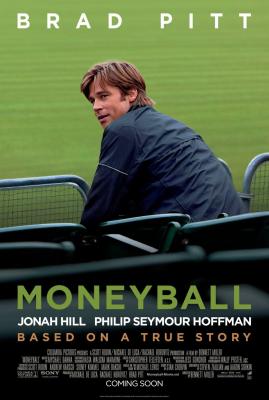
Sportfilme haben es nie leicht in Deutschland. Das hat mehrere Gründe: Zum einen sind die Deutschen so sportverrückt, dass Sport live vor Ort gesehen wird oder zu Hause vorm dem Fernseher; viele Kinogänger sind nicht zwingend dabei. Zum anderen reagiert der deutsche Durchschnittskinobesucher eher mit Abneigung auf pathetische Heldenverfilmungen, wie sie im Genre des Sportfilms oft genug vorkommen. Der letzte und meist entscheidende Grund für katastrophale Kinokassen-Ergebnisse ist die Wahl der Sportart. In den USA sind Sportarten wie Football, Basketball, Eishockey oder Baseball beliebt, die in Deutschland maximal eine Randnotiz in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Wenn also ein heldenhafter Sportfilm in einer für deutsche Verhältnisse unwichtigen Sportart in die Kinos kommt, geschieht dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Im Falle von Moneyball wird dieses Schicksal einen Film völlig zu Unrecht ereilen.
Brad Pitt überzeugt als Teammanager Billy Beane, der sich gegen ein ganzes System im Baseball stellt und mit einer zahlenorientierten Mannschaftsaufstellung auf Punktejagd in der amerikanischen Baseballliga geht. Aufgrund des geringen Budgets muss er dabei auf aussortierte Spieler zurückgreifen, die er Dank (großartig gegenbesetzt: Jonah Hill) des Wirtschaftsabsolventen Peter Brand und dessen Berechnungen auf dem Spielermarkt findet. Ob und wie sein System von Erfolg geprägt ist, behandelt der Film in seinen stattlichen 133 Minuten. Für Sportfremde ist es nicht immer leicht den Überblick zu bewahren, da nicht selten mit Fachbegriffen umher geworfen wird, die ein Außenstehender nicht verstehen kann. Dennoch liegt der Fokus hier nicht auf der Sportart Baseball, sondern auf der mutigen und einsatzstarken Leistung von Billy Beane, der mit einem hohen Maße an Loyalität sich für seinen Verein einsetzt. Schauspielerisch ist alles auf hohem Niveau, die Dialoge machen viel Freude und auch der Ausgang der Geschichte trieft nicht vor Kitsch und Pathos. Regisseur Bennet Miller inszeniert das Ganze mit einer angenehmen Zurückhaltung, die den Film auch für uns Europäer sehenswert macht. An einigen Stellen hätte man sich eine Kürzung gewünscht; trotz allem langweilt man sich kaum.
Das einzige Problem ist die fehlende Selbsteinordnung von Moneyball. Ist es ein Sportfilm, eine Tragikomödie, ein klassisches Drama oder was genau soll und will er sein?! Diese zeitweilige Orientierungslosigkeit sorgt für ein wenig Unverständnis und nimmt dem Zuschauer hin und wieder den Bezug zu den Figuren. Dennoch lohnt sich der Weg ins Kino für diejenigen, die gerne mal einen augenzwinkernden Blick hinter die Kulissen von einem Profisportverein blicken möchte. Gerade die Bedeutung von den Alteingesessenen, den Sportdinos, wird sofort bewusst du wie schwierig es ist, echte Reformen durchzusetzen. So einen großen Unterschied zum deutschen Fußball wird es da sicherlich nicht geben.
7/10

Klassischer kann man einen Spionagefilm kaum in Szene setzen. In Jeder Ecke spürt und riecht man den 70er Jahre Mief. Die Darsteller können durch die Bank weg überzeugen und liefern sich ein spannendes Kammerspielduell. Leider ist die Geschichte arg unübersichtlich geworden, sodass die einzige Schwäche, die manchmal zu sehr in den Vordergrund gestellte, Komplexität ist. Das soll dem Werk Vielschichtigkeit geben, nimmt aber letztlich einiges an Filmvergnügen ab.
Ausstattung und Kamera sind eine Augenweide und mit viel Liebe zum Details inszeniert. Für Fans von Old-School Spionageabenteuern ist das genau das Richtige, Freunde eher geradliniger Thriller wird der Film zu sperrig sein. Gary Oldman bei seiner oscarnominierten Leistung zuzusehen, ist Grund genug das Kino zu stürmen.
8/10

Es ist unvorstellbar, dass dieser Film auf einer erfolgreichen britischen Comedy-Serie basiert und in den Kinos auf der Insel unglaubliche 45 Millionen Pfund eingespielt hat. Die Geschichte von vier unglaublich weltfremden Losern, die nach Griechenland ihren Sauf- und Sexurlaub erleben wollen, ist nicht nur komplett unlustig, sondern gespickt mit derart ekelhaften und widerwärtigen Szenen und Einfällen, dass man sich selbst gerne einen Sangriatopf schnappen möchte, nur um blitzschnell die Leinwand voll zu kotzen. Eine Frechheit für jeden Besucher, der ernsthaft einen Euro für dieses Antivergnügen ausgeben wollte. Denn von den schlechten Darstellern und dem schlechten Drehbuch abgesehen, ist der Film auch noch handwerklich mies in Szene gesetzt worden. Der Schnitt und die Kamera sind lieblos und unachtsam behandelt worden und schmerzen dem Auge noch doppelt und dreifach. Mehr Worte braucht man nicht verlieren – zweifelsohne einer der schlechtesten Filme, die wir in 2012 zu Gesicht bekommen werden bzw. könnten.
1/10
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 12. Januar 2012
Verblendung + Offroad
dopo, 02:31h

Nach gerade einmal etwas mehr als zwei Jahren erscheint nun die US-Variante der erfolgreichen Millenium Trilogie in den deutschen Kinos. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt („Wieso muss das US-Kino so schnell ein Remake produzieren?“), ist hierbei denkbar einfach zu beantworten. Der amerikanische Filmmarkt produziert keine Synchronisationen von fremdsprachigen Filmen, wie wir es in Deutschland gewohnt sind. Der US-Markt ist aber selbstverständlich der Umsatzstärkste weltweit und da auch die wenigsten Deutschen gerne einen schwedischen Film mit Untertiteln schauen, wird der Film mit englisch sprechenden Mimen eben noch einmal neu gedreht. Der Ort des Geschehens bleibt dabei selbstverständlich Schweden, auch wenn der schwedische Akzent der Akteure nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass ein Daniel Craig nun kein Schwede ist. Dafür ist Gesicht des James Bond Darstellers einfach zu präsent.
David Fincher hat „The Girl with the Dragon Tatoo“ inszeniert und sprach vorweg vom krassesten Stoff, den er bislang in den Händen hielt und die Dreharbeiten dementsprechend hart für ihn und das Team gewesen sind. Bei einer erneuten Sichtung von „Sieben“ und auch der europäischen Version von Verblendung, verwundert die Aussage jedoch mehr als zu überzeugen. Niemand wird die Regiefähigkeiten von David Fincher jemals in Frage stellen wollen, dennoch ist der Film weitaus erträglicher und massentauglicher auf die Leinwand gebracht worden. Besonders krasse Bilder wurden ausgespart und bis auf die Vergewaltigungsszene (die im schwedischen Vorbild auch viel intensiver wirkte) bleiben Schockmomente, wie der geschickte Schnitt des Trailer vermuten ließ, weitestgehend aus. Dafür sieht man das größere Budget an jeder Ecke: Die Kameraarbeit ist atemberaubend und schlichtweg sensationell. Der Soundtrack und Score geht unter die Haut – die audiovisuelle Untermalung ist oscarverdächtig.
Es lohnt sich selbstverständlich auch mit Kenntnis der filmischen Vorlage der US-Variante eine Chance zu geben. Einige Momente wurden umgeschrieben und Kernthemen mit anderer Priorität ausstaffiert – heißt: Erzählstränge sind kürzer oder eben länger. Lediglich die Figurenentwicklung der Lisbeth Salander ist am Ende doch ein wenig unglaubwürdig. Dabei wird diese Figur von Rooney Mara atemberaubend interpretiert, wenn sie auch leicht hinter der legendären Darstellung von Noomi Rapace zurückbleibt und das mysteriöse Knistern zwischen Mikael Blomquist und Lisbeth Salander nicht in der gleichen Form zu überzeugen vermag.
Was bleibt ist eine tolle Hollywoodproduktion, dessen Verwirklichung sich zweifelsohne gelohnt hat und die Geschichte verdientermaßen somit weltweit noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Im direkten Vergleich müssen aber Abstriche gemacht werden. Mit einer Portion Toleranz geht das klar.
8/10

Deutsche Filme haben es oft schwer in bestimmten Genres Fuß zu fassen. Da haben es amerikanische Vorbilder oft leichter – so auch bei den sogenannten Road Movies. Eine Erklärung mag vielleicht sein, dass bei Road Movies der Freiheitsgedanke eine größere Rolle spielt und dieser Gedanke eben visuell viel besser durch unendliche Landschaften dargestellt werden kann. Davon gibt es in den USA natürlich hunderte Möglichkeiten, hingegen eine Bebilderung des deutschen Vorstadt und Dorfmief gar niemanden hinter dem Ofen herlockt. Dank der sehr beliebten Nora Tschirner und der verrückten Geschichte könnte dies bei OFFRAOD jedoch anders sein. Könnte!
Denn ein guter Film braucht mehr als eine sympathische Hauptdarstellerin. Ein vernünftiges Drehbuch sollte die Ausgangsposition dafür sein, ebenso wie eine gute Regie. Hier kommt dummerweise etwas viel Konjunktiv ins Spiel, was zeigt: Offroad bietet davon leider bei weitem nichts Zufriedenstellendes, obwohl der Storyansatz viel Möglichkeiten bietet: Vorortspießerin findet in einem Geländewagen 50kg Koks und versucht sich in der Großstadt als semiprofessionelle Drogendealerin. Die Umsetzung ist aber fahrig, unbedacht und schlichtweg langweilig. Höchststrafe für eine Komödie.
Der Trailer suggeriert dagegen ein kurzweiliges Vergnügen und beweist erneut, wie sehr eine gut zusammen geschnittene Collage den Zuschauer auf eine falsche Fährte bringen kann, um ihn so ins Kino zu locken. Doch hier gibt es nur ein Stichwort: Fern bleiben!
3/10
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 6. Januar 2012
Jonas
dopo, 13:05h

Seit einigen Jahren hat das Genre der Reality-Doku einen Platz im Kino gefunden. Nehmen wir Michael Moore oder Sascha Baron Cohen (besser auch bekannt als Borat oder Brüno), die Ihre Figuren in einer Realität zeigen, die hin und wieder fingiert ist. Der Trick: Der Zuschauer erfährt niemals, was geskriptet und was tatsächlich so passiert ist. Genau diese Tatsache macht diese Projekte so spannend, weil der Zuschauer merkt, wie er sich der Manipulation hingibt. Auf diese Vorbilder lose angelehnt, nimmt Christian Ulmen die Rolle des 18jährigen Jonas ein, der an einer Berliner Gesamtschule seine letzte Chance auf einen Schulabschluss erhalten soll. Das Verrückte an diesem Experiment ist: Die Lehrer wissen eigentlich, dass Jonas eine Figur von Christian Ulmen ist, die Schüler jedoch nicht. So vermischt sich auf eine sehr eigenwillige Art und Weise die Realität mit Fiktion. Denn Christian Ulmen bleibt nonstop als Jonas präsent, sodass die Lehrer sehr schnell vergessen, wer Jonas eigentlich ist.
Gefilmt wird also der echte Schulalltag, mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten. Selbstverständlich weiß Christian Ulmen zu jeder Zeit was er dort tut und macht es seinen Mitmenschen selten wirklich leicht. Entgegengesetzt zu seiner grandiosen Serie „Mein neuer Freund“ überschreitet Jonas hier keine Grenzen, um hemmungslos zu nerven und seine Welt in den Wahnsinn zu treiben, seine skurrilen Aktionen laufen stets auf ein Ziel hinaus: Mehr Sympathie zu sammeln – erschreckend, wie leicht dies zu gelingen scheint.
Der dokumentarische Stil der Bilder erweckt auch beim Zuschauer zwischendurch den Anschein eine echte Dokumentation zu sehen. Glücklicherweise ist man aber in der Lage sich aus der einseitigen Betrachtung zu befreien, im Zweifelsfalle tut es Jonas für uns. Der Film überzeugt jedoch nicht nur mit seiner schrägen Grundsituation und den teils sensationellen Einfällen, sondern hebt auch die in Verruf geratene Situation an den deutschen Schulen hervor. Denn wir sind nicht auf einem Elitegymnasium, sondern einer stinknormalen Gesamtschule. Also liebe Schwarzmaler da draußen – seht selbst, unsere Jugend ist zum größten Teil mehr als akzeptabel. Der Film bleibt trotzt kleinerer Längen ehrlich und präsentiert eine bittere, wenn auch wahre Pille, die wir alle wohl schlucken müssen. Mit Sympathie kommt der Mensch im Leben weitaus weiter als mit Leistung. Wobei, wir alle waren Schüler! Im tiefen Inneren wussten wir das doch schon immer.
8/10
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 6. Dezember 2011
Perfect Sense
dopo, 17:11h

Und wieder kommt ein Film ins Kino, der die Apokalypse heraufbeschwört, weil eine Pandemie sich schnell verbreitet und somit das Aus für menschliches Leben auf der Erde bedeutet. Wer braucht nach dem hervorragenden Contagion im Jahre 2011 noch einen weiteren Film dieser Art? Diese Frage ist nicht unberechtigt, doch die Antwort ist weitaus gelassener und auch überraschender als man es sich vorstellen konnte. Denn Regisseur David Mckanzie hat sich ein Drehbuch ausgesucht, was nicht mit dem klassischen Verlauf eines Virus-Films spielt. In dieser Endzeitutopie betrifft die Ausbreitung schließlich nicht nur einen Teil der Menschen und löst auch nicht sofort den qualvollen Tod aus. Nein, hier geht es an essentielle Teile der Menschheit, Dinge, die für jeden im Leben selbstverständlich sind: Die Sinneswahrnehmungen.
Plötzlich verliert eine Vielzahl der Menschen kurzzeitig und nur für wenige Augenblicke den Verstand. Nachdem diese Phase geprägt von Heulkrämpfen und überwältigenden Schuldgefühlen durchlebt ist, ist die Gabe Gerüche wahrzunehmen vollends vernichtet. Einen Grund dafür scheint es nicht zu geben und die Geschichte beleuchtet auch keineswegs die Versuche einen Auslöser für diese Pandemie zu finden. Viel mehr wird die menschliche Fähigkeit sich Gegebenheiten anzupassen fokussiert. Ohne Geruchssinn wird’s schon gehen, das Leben muss weiter gehen. Die restlichen Sinne werden geschärft, man konzentriert sich auf das Wesentliche. Dieses Vorgehen wird jedoch auf die Probe gestellt, wenn immer mehr wichtige Sinne des alltäglichen Lebens für immer aus dem Leben scheiden. Wie stellt man sich darauf ein ohne Geschmackssinn, ohne die Fähigkeit zu hören oder gar zu sehen auf der Welt als Mensch zu existieren.
Dieser Gedankengang wird in intensiven Bildern gezeigt und von den beiden Hauptdarstellern Eva Green und Ewan McGregor packend und überzeugend getragen. Beide haben ihr Vertrauen in die Liebe und die Zweisamkeit verloren. Im Laufe des Films müssen die Protagonisten doch genau dieses Vertrauen für sich wieder entdecken, denn es könnte das Letzte sein, was ihnen bleibt. Diese schwierige Herausforderung darauf einen schlüssigen, spannenden und berührenden Film zu inszenieren ist gelungen, auch wenn die emotionalen Ausbrüche vor jeder weiteren Krankheitsstufe aufgrund ihrer grotesken Ausuferungen sehr verstören. Der Ernst der Lage wird dem Zuschauer bewusst, dennoch überträgt sich der durchblickende Hoffnungsschimmer auch auf den Zuschauer. Es wirkt echt, menschlich, authentisch und ist dabei unglaublich intensiv.
Ob man Perfect Sense als reinen apokalyptischen Thriller oder als mehrdimensionale Kritik auf unser gesellschaftliches Zwischenleben sehen möchte, wird offen gehalten und gibt viel Spielraum der Interpretation. Einzig die Frage, ob man einen weiteren Endzeitfilm wirklich sehen muss, beantwortet er mit einem klaren JA, denn auf diese unpanische Weise wurde selten dieses Szenario bebildert.
9/10
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 22. November 2011
Twilight - Breaking Dawn Teil 1
dopo, 20:39h

Es gibt Filme, bei denen es beinahe Zeitverschwendung ist eine Kritik zu schreiben, weil sich dafür eh niemand wirklich interessiert. Die Twilight Reihe gehört definitiv in diese Kategorie. Die Fans lieben jeden Streifen sowieso, alle anderen schauen sich die Vampirsaga gar nicht erst an. Daher ist jede Empfehlung seitens der Kritiker fast zwecklos. Journalistische Ideale treiben allerdings jeden Autor an, sodass auch der vierte Teil „Breaking Dawn“ nun besprochen wird.
Edward und Bella heiraten also endlich, fahren in die Flitterwochen und haben das erste Mal Sex, wobei auch sofort ein Kind gezeugt wird. Dieses Kind wird jedoch zum Überlebensrisiko für Mutter Bella, da sie selbst noch kein Vampir ist, das Kind aber ein bisher undefiniertes Mischwesen, welches nicht nur schneller wächst als ein normales Embryo, sondern das Wachstum gar die Knochen der Mutter zu brechen droht. Ihr Schicksal ruft die Werwölfe dazu, die gegen die Vampire in die Schlacht ziehen wollen und Bella vor ihrem sicheren Tod retten wollen.
Prinzipiell könnte das Treiben tatsächlich spannend inszeniert werden, wenn man diese Zeilen liest. Der Film belässt es aber beim Konjunktiv und verlässt niemals das Niveau einer Seifenoper im TV. Glattpoliert, unauthentisch und gelangweilt stehen die Darsteller im Set und warten auf die nächste Regieanweisung. Der Anfang ist selbstverständlich hochkitschig dargestellt, wir wollen eine Hochzeit feiern. Doch anstatt die Zeremonie ordentlich zu würdigen, bleibt die Kamera lieber beim Weg zum Altar bei jedem Schritt in Zeitlupe auf dem Hochzeitskleid hängen. Das „ich will“ ist Nebensache; das Kleid ist die Attraktion. Potenzial wird jede Sekunde verschenkt.
Auf diese Art und Weise heult der Film jedem Kleinmädchentraumklischee hinterher, wobei kein Frauenklischee aus der Steinzeit ausgelassen wird. Im Jahre 2011 spricht man über die Frauenquote und die Gleichberechtigung ist beinahe durchgesetzt. Im direkten Gegensatz feiert die weibliche Fanschaft von Twilight eine verfilmte Bücherreihe, die ein uraltes Frauenbild vermittelt: Die Frau opfert sich auf für den Mann und spart sich für ihn auf, sie leidet für das Familienglück und will das Kind trotz aller gesundheitlichen Bedenken doch auf die Welt bringen. Ein gesundheitsbedingter Schwangerschaftsabbruch kommt in dieser christlichen und moralinverseuchten Twilight-Welt nicht in Frage. Aber was spielt das für eine Rolle, wenn man Edward und Jacob bei ihren Auseinandersetzungen hinterher schmachten kann. Das größte Drama ist jedoch, dass 117 Minuten beinahe nichts passiert. Nichts, Langeweile, Stillstand!
Rein technisch gesehen ist die Reihe immerhin im 21. Jahrhundert angekommen. Die Kamerafahrten sind in der tollen Landschaft wirklich sehenswert, die Ausstattung und Spezialeffekte funktionieren auf hohem Niveau. Das sieht auch endlich nach Hollywood und großem Kino aus. Es bleibt aber eher zweifelhaft, dass sich die Story und die schauspielerischen Leistungen der Darsteller im letzten Teil auch noch in diese Richtung entwickeln werden.
2/10
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 29. September 2011
The Guard + zwei Bewertungen
dopo, 16:47h

Die Filmgeschichte kennt schon den einen oder anderen verrückten Kauz. So jemanden wie Gerry Boyle trifft man aber nicht einmal im Kino wirklich oft. Denn einen wirklich passenden Ausdruck findet man nicht. Da passt „unberechenbar“ wohl wirklich am besten. Gerry Boyle ist Polizist in einem kleinen Ort in Irland und er führt diesen Job auf seine eigene, sehr unkonventionelle Art und Weise durch, dabei aber im tiefen Inneren stets mit einer guten Intention und niemals unehrlich oder gar verlogen. Ein merkwürdiger Mord ist geschehen, ein mysteriöser Selbstmord eines Polizisten folgt unmittelbar danach. Aber Boyle will diesen Fall unbedingt lösen, ohne Kompromisse.
„Entweder sind sie ein völliger Idiot oder der cleverste Bursche überhaupt“ – diesen Satz spricht FBI Chef Wendell Everett (Don Cheadle), der zu Lösung des Falls auf die Insel geordert wurde. Die Aussage ist nicht unberechtigt, denn auch der Zuschauer fragt sich oft genug, ob Boyle diesen Satz wirklich gesagt hat oder nicht. Politische „Correctness“ braucht offenbar kein Mensch!
Obwohl ein Mord gelöst werden muss und obwohl der Film an einigen Stellen unglaublich witzig ist, ist der Film weder Krimi noch Komödie. Brendan Gleeson spielt den letzten ehrlichen Polizisten der Stadt in einer Cowboy-Manier, dass er tatsächlich der Letzte zu sein schein, der den Gesetzlosen noch etwas entgegen zu setzen hat. Ja, das ist der erste irische Westernfilm.
Die schrägen 96 Minuten sind schnell vergangen, trotz kleinerer Durchhänger im Mittelteil. Das Gespann Gleeson/Cheadle harmoniert perfekt, die Regie strotzt vor verrückten Einfällen und nimmt sich dankenswerterweise nicht selbst sonderlich ernst. Somit bekommt der Zuschauer ein Kinovergnügen der sehr besonderen Art.
8/10
Freunde mit gewissen Vorzügen
Teils etwas affektiert gespielter Streifen, der Dank seiner charmanten und gutaussehenden Darsteller grundsolide Unterhaltung bietet. Nicht mehr, nicht weniger.
6/10
Kill the Boss
Anfangs zum Schreien komische Komödie, die gegen Ende leider arg absäuft und konventionell hoch 1000 um die Ecke kommt. Kevin Spacey, Jennifer Aniston und Colin Farrell besetzen die Nebenrollen perfekt und sorgen demnach für die meisten Lacher.
7/10
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 18. August 2011
Captain America + Midnight in Paris
dopo, 14:10h

Mittlerweile erscheinen jedes Jahr zahlreiche Comicverfilmungen im Kino. Einige Werke der letzten Jahre strotzen vor Individualität, Tiefe oder geistreichen Ideen. So bieten die beiden Batman Werke von Christopher Nolan, die Iron Man Filme oder auch die diesjährige X-Men Verfilmung neben großartiger Mainstreamunterhaltung auch tiefsinnige und mehrdimensionale Ansätze, die sich wohltuend vom Einheitsbrei Hollywoods abheben.
Nun erscheint Captain America in den deutschen Kinos. Sämtlich erwähnte positive Ausführungen der aktuellen Vorbilder lassen sich auf diese Leinwandadaption leider nicht reflektieren.
Steve Rogers ist ein schmächtiger junger Mann, der im Jahre 1942 nichts lieber täte, als für sein Land in den Krieg zu ziehen. Dank eines wissenschaftlichen Experimentes gelingt es aus Rogers einen stahlharten Übermenschen zu erschaffen, dessen menschlichen Eigenschaften ebenfalls durch die Verwandlung verstärkt werden; sowohl die positiven als auch die negativen Ausprägungen sollen sich im erhöhten Maße auf den Charakter auswirken. Doch genau an dieser Stelle wird das größte Problem der Verfilmung deutlich. Steve Rogers bzw. Captain America ist ein eindimensionales Abziehbildchen einer heroischen Figur des Krieges. Die wichtige Aussage bezüglich der persönlichen Merkmale verpufft nach wenigen Momenten und wird schlichtweg nicht mehr berücksichtigt. Unglaublich viel Potenzial für eine glaubwürdige Darstellung geht unkommentiert unter.
Captain America bleibt durchweg eine Kampfmaschine, die sich heldenhaft für die USA einsetzt. Warum man sich jetzt zwingend für den mutigen und mitfühlenden Steve Rogers zur Ausübung des Experimentes entschieden und keinen stumpfsinnigen Soldaten ausgewählt hat, wird zu keiner Sekunde deutlich. Denn nach der Verwandlung ist Captain America selbst nur eines: Plump. Dem Helden fehlt es völlig an Ecken und Kanten, hinterfragt wird nicht und menschliche Eigenschaften existieren für keinen weiteren Moment. Dabei sollte er doch genau das versprechen: Ändere dich nicht!
Das Ergebnis daraus ist ein willkürlicher Brei aus Actionsequenzen, die völlig spannungsfrei am Zuschauer vorbeirauschen, weil die Geschichte bis auf eine kleine Ausnahme so glatt am Protagonisten vorbeiziehet dass man gelangweilt im Kinositz verharrt. Die humorigen Elemente sind abgelutscht (einen Vorgesetzten, der als trockener Stichwortgeber verkommt, hat man schon viel zu oft gesehen – Tommy Lee Jones ist sichtbar unterfordert), den satirischen Elementen fehlt der Biss und der Bösewicht ist ein Mix aus Fantasy und Nazi. Wirklich böse ist das nicht, sondern eher unfreiwillig komisch. Was bleibt ist ein austauschbares Action-Filmchen, was bedeutungslos 124 Minuten über die Leinwand flimmert. Bedeutungslos auch die 3D Technik, die von Mal zu Mal fragwürdiger wird. Nein, dann doch lieber Batman, Iron Man oder die X-Men. Die haben im direkten Vergleich noch viel mehr zu bieten, als es man sich vorher bewusst war. Dort wird zwar keine räumliche Tiefe vorgegaukelt, das Endergebnis ist dafür um einige Facetten mehrdimensionaler.
3/10
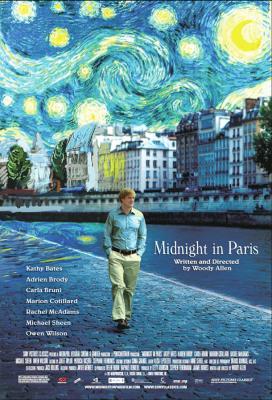
Woody Allen ist zweifellos einer der großen Filmemacher, der sich niemals vom Mainstream hat weichspülen lassen. Auch sein neustes Werk ist dafür wieder einmal der perfekte Beweis. So leichtfüßig die Komödie auch daher kommen mag, der Charme und die magische Atmosphäre brennen sich tief ins Gedächtnis.
Der Drehbuchautor Gil möchte keine weiteren Fließbandgeschichten mehr für Hollywood schreiben, sondern will den Schritt in die echte Literatur wagen (Alleine die Ausgangssituation ist ein herrlicher Seitenhieb in Richtung des Blockbuster Kinos). Er ist fasziniert von der Atmosphäre in Paris und sieht in der Stadt einfach mehr als ein Shoppingparadies für Modebegeisterte. Seine Verlobte kann dem Ganzen nicht viel abgewinnen, wie auch ihre (großartig überzeichnete) Eltern. Eines Abends hat Gil kein Interesse an einer Partynacht und macht sich stattdessen auf einen melancholischen Streifzug durch die Straßen. In dieser Nacht geschieht etwas Eigenartiges, er wird in das Paris der 20er zurückkatapultiert, für ihn DAS goldene Zeitalter dieser Stadt. Dort trinkt er mit Hemmingway, lernt die sehr spezielle Partnerschaft der Fitzgeralds kennen und trifft die Künstler Dalí und Picasso.
Woody Allen skizziert feinfühlig den Weg eines orientierungslosen Mannes durch seine eigenen Ideale, um am Ende recht simpel, aber einleuchtend zur Erkenntnis des Filmes zu gelangen. So werden seine Vorstellungen der perfekten Gegenwart nicht nur relativiert, sondern es stellt sich ebenfalls heraus, dass in der Zukunft ganz offensichtlich auch Menschen existieren werden, die uns um das Hier und Jetzt beneiden werden. Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, beobachtet Allen zahlreiche Eigenarten der Gegenwart wie, dass das Interesse an Kultur und Kunst sich nicht zwingend über endloses angelesenes Wissen definiert. Ebenso ist es laut Allen oberflächlich, sich zwanglos überzeugend vorgetragenen Fakten hinzugeben, um kultiviert zu erscheinen (wie die Verlobte Inez von Gil). Die Weißheit: „Stil kann man nicht kaufen, sondern man muss ihn haben“ bringt er durch ein irrwitziges Zitat der Mutter von Inez zum Vorschein. Ja, es sind diese vielen kleinen Details, die das Drehbuch zu einem ganz besonderen Stück machen und dem Film zu großem Glanz verhelfen.
Lediglich gegen Ende sind ein paar kleine Schwächen zu erkennen. Ein paar Minuten mehr der Auflösung hätten der Geschichte gut getan und das Drumherum etwas glaubwürdiger erscheinen lassen. Die Schwächen sind jedoch nur marginal. Die Liebeserklärung an das kreative und künstlerische Schaffen überwiegt und macht „Midnight in Paris“ zu einem zauberhaften Kinovergnügen.
9/10
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 15. August 2011
Super 8 + Bewertung Blue Valentine
dopo, 13:10h

Sommer ist Blockbusterzeit! Seit geraumer Zeit auch eher Sequel-Zeit. Nicht wenige zweite, dritte und vierte Teile kommen auf die Leinwand und können dabei eher selten restlos überzeugen. In diesem Jahr erscheint eine Großproduktion, die weder eine Comicvorlage, einer TV-Serie oder einem Vorgänger entsprungen ist. Nein, SUPER 8 wurde ausschließlich für das Kino geschrieben.
Eine Jugendclique will in den Sommerferien einen Film für ein Filmfestival produzieren und wird Zeuge eines Zugunglückes, welches nicht ohne Grund von ihrem Lehrer hervorgerufen wurde. Seltsame Würfel haben die Waggons geladen und scheinen aus einer anderen Welt zu sein. Als plötzlich immer wieder Personen aus der Kleinstadt verschwinden, wird schnell klar, dass ein mysteriöses Geschöpf sein Unwesen treibt. Die Geschichte ist dabei vielschichtiger als man auf den ersten Blick erkennen kann. Neben dem Sciene-Fiction Element fokussiert J.J.Abrams auch das Familiendrama zwischen Protagonist und Vater, die beide auf ihre Art und Weise mit dem tragischen Tod der Mutter zu Recht kommen müssen.
Der Film erzählt die Geschichte glücklicherweise nicht auf die moderne Art und Weise, sondern bringt nostalgische Atmosphäre in die Kinosäle! Die Bilder könnten 25 Jahre alt sein, die Charaktere sind allesamt fein ausgearbeitet, sympathisch und mit hohem Identifikationspotenzial ausgestattet. Der Hauch Selbstironie fehlt ebenfalls nicht. Kinomagie beherrscht das Publikum, wie es viel zu selten noch gelingt. Lediglich das Ende ist zu amerikanisch ausgefallen und die Darstellung des Showdowns ist arg übertrieben.
Wenn zwei der ganz Großen der Filmschaffenden zusammen kommen, muss das nicht immer ein Garant für großartige Unterhaltung sein (siehe Indiana Jones 4), aber in diesem Fall ist Super 8 der Sommerblockbuster schlechthin, der mit seiner Detailversessenheit eine Liebeserklärung an die Blockbuster der 80er Jahre ist. Wer über die kleinen Schwächen am Ende hinwegsehen kann, hat viel Freude für den normalen Kinotarif, denn vor 25 Jahren liefen die Film nicht in 3D.
9/10
Blue Valentine
Realistisches, bedrückendes und trauriges Résumé einer gescheiterten Beziehung, an der beide viel zu lange festgehalten haben.
8/10
... link (0 Kommentare) ... comment
... older stories